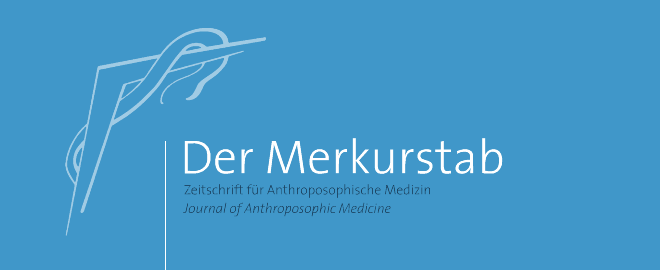
HEFT 5/2014
Der Merkurstab | September/Oktober 2014 | 22,00 Euro (inkl. Mwst., zzgl. Versandkosten)

| Artikel | Person und Bewusstsein im "Hirntod"-Konzept aus neurologischer Perspektive Person and conscious awareness in the ‘brain death’ concept from a neurological point of view |
| Autor | Friedrich Edelhäuser |
| Seiten | 349-361 |
| Volume | 67 |
Zusammenfassung
Der Artikel erörtert die Probleme, die aus dem sog.
"Hirntod"-Konzept erwachsen, aus neurologischer
Perspektive. Ausgehend von der verbreiteten und im
Transplantationsgesetz so formulierten Annahme,
dass der irreversible Funktionsausfall des Gehirns,
eines Teils eines Organs des Menschen, mit dem Tod
des Menschen gleichzusetzen sei, führt der Autor die
Unzulänglichkeit dieser These anhand mehrerer Belege
aus. Die Argumentation stützt sich dabei u. a. auf
Arbeiten von Alan Shewmon, einem US-amerikanischen
Neurologen und Pionier einer wissenschaftlich
kritischen Haltung zum Konzept des Hirntods. Dass
eine reine naturwissenschaftliche Erfassung des Hirntods
ohne Einbezug der - offenbar auch unabhängig
davon existierenden - Bewusstseinsebenen zu kurz
greift, wird mit Bezug auf die von Rudolf Steiner entworfene
Dreigliederung des Menschen sowie auf
beobachtbare neurologische Phänomene und die
sog. Nahtoderlebnisse erörtert. Den Artikel runden
Empfehlungen zum medizinisch-ethischen Umgang
mit der für alle Beteiligten extrem herausfordernden
Situation einer (potenziellen) Transplantation ab.
Zentrale Bedeutung erlangt dabei der formulierte
Patientenwille des Spenders und die damit verbundene
Notwendigkeit einer umfassenden Aufklärung, die
Kontroversen, unterschiedliche Gesichtspunkte und
ungelöste Fragen des "Hirntod"-Konzepts einbezieht.
Abstract
The problems arising from the ‘brain death’ concept are
considered from a neurological point of view. Starting
with the widespread assumption, formulated as such
in transplantation law, that irreversible loss of function
of the brain, part of a human organ, must be seen as
the individual’s death, the author considers the inadequacy
of this thesis, substantiating this in a number
of ways. Among other things his argument is based
on papers by Alan Shewmon, an American neurologist
and pioneer of a critical scientific approach to the brain
death concept. A purely natural-scientific view of brain
death, not including the levels of conscious awareness
- which evidently also exist independently of it - does
not meet the case. This is discussed with reference to
the threefold nature of the human being postulated by
Rudolf Steiner as well as observable neurological phenomena
and ‘near-death experiences’. The paper concludes
with recommendations for dealing in an ethical
medical way with a situation, challenging for everyone
involved, of (potential) organ transplantation. Central
significance attaches to the donor’s formal written will
and the need for extensive information this involves,
covering the controversies, different points of view and
unsolved issues of the brain death concept.
